#Lesestoff
KI und Deutschland – die “German Angst“

Die Angst vor der Zukunft und vor Veränderungen scheint vor allem dort präsent zu sein, wo sich die Deutschen nicht mit KI auskennen, und nicht täglich mit ihr zu tun haben. „KI ist doch gefährlich, oder?“ ist da noch eine der harmlosesten Fragen. Es gibt nicht wenige Deutsche – aber natürlich auch weltweit viele Menschen – die sich Sorgen um die Risiken und Nebenwirkungen von KI machen. Deshalb trafen sich im November 2023 Vertreter*innen aus 30 Nationen zu einem Gipfeltreffen in Großbritannien, um über die Regulierung von KI zu diskutieren und Standards zu erarbeiten.
Zu einem gewissen Grad ist die „German Angst“, wenn es um KI geht, also nicht nur ein deutsches Phänomen. Die Sorge ist verständlich und es ist wichtig, darüber zu sprechen.
Doch wir Deutschen scheinen in mancher Hinsicht ein bisschen vorsichtiger zu sein als andere Länder. Vielleicht liegt das an unserer historischen Vergangenheit, die immer wieder von extremer staatlicher Überwachung und Kontrolle geprägt war. Eine gewisse Skepsis gegenüber KI-Systemen rührt vermutlich daher, große Mengen an Daten könnten in den falschen Händen landen.
Doch wir befinden uns gerade jetzt in einer Zeit, in der es viel mehr Mut bräuchte, anstatt zurückhaltende Vorsicht.
Die „German Angst“ ist allerdings nicht der einzige Grund, warum der starke Wirtschaftsstandort Deutschland im KI-Bereich noch einige Schwächen aufweist.
Nachdenken, bis es zu spät ist
Vieles, was ich bereits im EU-Kapitel geschrieben habe, trifft natürlich auch (oder vor allem) auf Deutschland zu. Deshalb nur kurz zur Erinnerung: Wir wissen, KI wird überwiegend durch die amerikanischen Hyperscaler entwickelt und betrieben – das heißt, auch Deutschland nutzt zu etwa 50 Prozent diese Infrastruktur.
Was die Modelle betrifft, habe ich bereits ein paar vielversprechende Unternehmen wie Aleph Alpha und DeepL erwähnt, die aus Deutschland kommen, aus international-deutschen Teams bestehen und verhältnismäßig viel Kapital erhalten haben. Trotzdem sind sie im Vergleich zu den amerikanischen Modellen nicht wettbewerbsfähig. Denn während Amerikaner einfach loslegen, hält uns unsere Vorsicht zurück. Die Angst davor, Fehler zu machen. Denn die deutsche Kultur ist leider von einer hohen Fehlerintoleranz geprägt. Das führt dazu, dass sich selbst die mutigsten Gründer*innen nicht trauen, ein halbfertiges Produkt auf den Markt zu bringen. Einfach, weil sie wissen, dass KI Fehler macht – und wir wollen keine Fehler. Doch ChatGPT halluziniert, lügt und generiert auch dann „Antworten“, wenn es gar keine richtige Antwort auf eine Frage hat. Dieses Verhalten ist mit der deutschen Kultur größtenteils unvereinbar. Wir Deutschen bringen zum Beispiel auch kein Auto auf den Markt, von dem wir wissen, dass jedes zehnte wahrscheinlich nicht funktionieren oder gegen den Baum fahren wird. Natürlich spricht das auch für uns, für deutsche Qualität und Zuverlässigkeit. Doch in den USA geht man viel pragmatischer und mutiger an die Dinge heran. Das heißt zwar nicht, dass dort wissentlich Autos verkauft werden, die tödlich sind, aber es herrscht eine Kultur des „Just do it“, während wir Deutschen sehr lange darüber nachdenken, bevor wir etwas wirklich umsetzen. Das ist ein Luxus, den wir uns im digitalen Zeitalter nicht mehr leisten können. Würde die Welt allein aus einem deutschen Markt bestehen, wäre das noch möglich, aber im internationalen, digitalen Wettbewerb ist unser zögerliches Verhalten einfach nicht förderlich. Denn hier läuft nichts mehr ohne Trial-and-Error, ohne Iterationen (also Entwicklungs- und Verbesserungsschleifen) und ohne sogenannte Sprints (2-4-wöchige Projektperioden).
Doch es besteht noch Hoffnung für den deutschen Markt, denn die Anzahl der Startups wächst. 2023 gab es bereits circa 600-700 KI-Unternehmen in Deutschland. Zum Vergleich: Als ich 2016 erstmals angefangen habe, diese Unternehmen zu zählen, waren es nur 80. Da passiert also einiges. Auch das Investitionsvolumen für diese Unternehmen ist gestiegen. Dennoch ist der deutsche Markt vergleichsweise klein und das liegt – wie auch schon auf Europa-Ebene – am Kapital. Startups sind chronisch unterfinanziert. Dabei gäbe es jede Menge Möglichkeiten, diese Projekte zu fördern. Ein geeignetes Werkzeug hierfür könnte die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND sein. SPRIND kann seit diesem Jahr dank eines eigenen Gesetzes wesentlich freier handeln. Sie schnell und selbständig über Forschungs- und Gründungszuschüsse entscheiden; kann Wandeldarlehen gewähren und bei Eigenkapitalfinanzierungen mitmachen. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn SPRIND in Kürze zu einer oder mehreren “SPRIND Challenges” zu KI-Themen aufruft und einlädt.
Zum Thema Daten ist bereits im Europa-Kapitel das Wichtigste erwähnt worden. Doch auch hier stellt Deutschland einen Sonderfall dar, denn wenn es darum geht, die DSVGO einzuhalten, sind wir Deutschen besonders strebsam. Das ist einerseits lobenswert, weil wir uns sehr für den Datenschutz stark machen und uns die Privatsphäre unserer Bürger*innen wichtig ist. Leider hat es zur Folge, dass wir dadurch noch zaghafter mit KI umgehen als die meisten anderen europäischen Länder. Vor ein paar Jahren führte ich beispielsweise ein Gespräch mit einem ehemaligen Staatssekretär, der mir zu verstehen gab, dass Daten in seiner Behörde als Staatsgeheimnis betrachtet würden. Deutschland habe keine Kultur des Open Source, sondern sammelt, segmentiert und verschließt alle Daten als „Verschlusssache“, gelagert hinter dicken digitalen Tresorwänden. Daten teilen kommt uns nicht in den Sinn – und in diesem Fall ging es gar nicht um personenbezogene Daten. Vielmehr ging es um Daten, die eigentlich Allgemeingut und für alle Bürger*innen zugänglich sein sollten, denn indirekt bezahlen wir dafür, dass diese Daten erhoben und verwaltet werden. Doch das ist mit unserer Kultur noch nicht vereinbar.
Forschen, bis andere daran verdienen
Unsere Universitäten sind gut. Wenngleich mehr Forschungsergebnisse aus semiforschungsnahen Bereichen kommen, wie zum Beispiel aus dem Fraunhofer– oder dem Max-Planck-Institut. Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch nochmal das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI), das seit über 30 Jahren angewandte KI-Forschung betreibt und renommierte Investoren wie Alphabet, Amazon und NVIDIA, aber auch deutsche Unternehmen anziehen konnte.
Nichtsdestotrotz schafft es bisher kein deutsches Forschungsinstitut auch nur ansatzweise, an die Anzahl der erfolgreichen Ausgründungen heranzureichen, mit denen beispielsweise Harvard, Stanford oder das MIT glänzen können. Es ist ein deutsches Dilemma, denn wir wollen Grundlagentechnologien erforschen und Dinge erfinden – darin sind wir gut. Aber die Erfindungen deutscher Universitäten schaffen es selten in die Ausgründung und erwirtschaften dadurch weder Kapital noch bringen sie den verdienten Erfolg.
Ich wette, du erinnerst dich beispielsweise nicht an die Veröffentlichung des Forschungsprojekts „ISO Standard IS 11172-3 MPEG Audio Layer 3“ des Fraunhofer Instituts vom 14. Juli 1995. Aber ich glaube, dass du dich an die Präsentation im Jahr 2001 des damaligen Apple-Chefs Steve Jobs erinnerst, als er den ersten iPod präsentierte. MP3, die Abkürzung für die Technik, die das Komprimieren von Musik möglich machte, wurde von Forscher*innen in Mittelfranken erfunden. Die deutsche Industrie hielt diese Erfindung allerdings damals leider für irrelevant. Das Ende des Liedes kennen wir alle: Apple verdiente mit dieser „irrelevanten“ Erfindung Milliarden! Heute nennen wir das den MP3-Effekt, denn es ist leider eher ein Muster als die Ausnahme: Wir Deutschen erfinden erfolgreich Vieles, aber Geld verdienen später andere – zum Beispiel die Amerikaner.
Gleichzeitig möchte ich unsere Forschung in Schutz nehmen, da sie unter chronischem Geldmangel leidet und deshalb gezwungen ist, sich stark zu spezialisieren, um der finanzkräftigeren Konkurrenz zu entkommen. Hinzu kommt, dass unsere Elfenbeintürme zu sehr auf ihr akademisches Ansehen ausgerichtet sind. Es geht vielmehr darum, Artikel zu veröffentlichen und dafür Anerkennung zu bekommen, anstatt Ausgründungen voranzutreiben und einen gesellschaftlichen oder unternehmerischen Mehrwert zu erschaffen.
Zögern, bis wir offline sind
Anstatt, dass Deutschland Kapital für Innovation in den Digitalsektor investiert, ziehen wir Geld ab. Wir geben zwar sehr viel Geld für Grundlagenforschung aus, aber zu wenig Geld für unsere Startups. Also für Unternehmen, die die Arbeitsplätze von morgen schaffen und die Steuern von übermorgen bezahlen. Um das zu ändern, sehe ich zum einen die deutsche Industrie in der Pflicht, dort ganz besonders den Mittelstand. Hier braucht es mehr Vernetzung und Mut. Grundsätzlich fließt zu wenig „altes Geld“ in die New Economy.
Ich sehe den deutschen Staat, besonders die Bundesregierung, in der Pflicht, diese Vernetzungen weiter voranzutreiben. In persönlichen Gesprächen mit Abgeordneten aus fast allen Fraktionen habe ich in den letzten zehn Jahren immer wieder über die Vorherrschaft der USA und China aufgeklärt und an den Bundestag und die Bundesregierung appelliert, dass wir aus den genannten und bekannten Gründen endlich aufholen müssen. Die Köpfe nickten und versprachen zu handeln. Doch das Ergebnis war jedes Mal ernüchternd, denn die Abgeordneten gingen zurück ins Parlament und taten: nichts.
Der Grund ist so einfach wie fatal: Unsere Regierung betreibt keine Zukunftspolitik bzw. keine Technologiepolitik.
Als ich 2017 als Experte im Bundestag saß, ging die Meinung der Abgeordneten noch in Richtung: „KI wird noch eine Weile brauchen!“
Noch zu Beginn des Jahres 2023 sagte man mir in einem Bundesministerium, dass die anderen Ministerien das Thema KI noch immer nicht ernst nehmen würden. KI würde ignoriert und im Zentrum stünde vielmehr das Thema Klima, nicht die Themen Technologie, Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz.
Digitalbudgets werden gekürzt. Wir sind nicht nur analog, wir sind offline. Der gesamte Verwaltungsstaat steckt noch im Web 1.0. Ich kann vielleicht online einen Termin vereinbaren, muss aber trotzdem physisch zur Behörde laufen, um den Personalausweis zu verlängern. Wenn ich Glück habe, muss ich nicht nochmal kommen und eine Geburtsurkunde nachreichen, die ich schon mehrmals vorgelegt habe. Wenn ich Pech habe, läuft es wie beim Passierschein A38 bei Asterix und Obelix: ein endloser bürokratischer Wahnsinn. Ich frage mich, wie lange ich noch davon träumen muss, meinen ganzen Papierkram nur noch vom Rechner aus zu erledigen. Wie lange muss ich noch in Ämtern während stundenlanger Wartezeit Automatenkaffee (falls der Automat denn funktioniert) trinken und Zeit vergeuden für Dinge, die in anderen Ländern längst digital ablaufen? Ich glaube, so lange, bis unsere Regierung endlich anfängt, digital und zukunftsfähig zu denken. In der Zwischenzeit hängt Deutschland sich selbst ab. Bürokratie ist inzwischen zum wichtigsten Grund geworden, warum Unternehmen ins Ausland abzuwandern. Das ist sehr schade, denn ich weiß, wir können es besser!
Es braucht einen kulturellen Wandel. Doch der muss zuerst von der Politik ausgehen. Wenn der Bund sich ändert und anfängt, zukunftsfähig zu denken und zu handeln, wird die Gesellschaft folgen.
Regional gut, bundesweit weiter ausbaufähig
Zum Glück hat das Jahr 2023 einiges angestoßen. Seit Sommer 2023 widmen sich führende Politiker*innen mehr und mehr dem Thema und auch der Bundeskanzler hat die Bedeutung Künstlicher Intelligenz erkannt. Er trifft sich seitdem mit KI-Expert*innen und initiiert Arbeitsgruppen. Die Ministerien für Wirtschaft, Forschung, Digitales und Verteidigung haben jeweils eigene KI-Budgets eingeplant und ich bin zuversichtlich, dass diese Budgets trotz Schuldenbremse in den kommenden Jahren aufgestockt werden. Das Thema nimmt also auch auf Bundesebene endlich langsam Fahrt auf.
Zudem haben wir in Deutschland viele Talente, die das Thema KI vorantreiben und einen eigenen, einen „deutschen Weg“ beschreiten. Dieser deutsche Weg ist sehr regional geprägt und in den Bundesländern etablieren sich spannende Initiativen.
Es gibt inzwischen zahlreiche Verbände, die sich vernetzen und austauschen. Einer der ersten Verbände war der KI-Bundesverband e. V. Dazu kommen zahlreiche regionale Hubs, wie KI.NRW, AI.GROUP, die KI-Allianz Baden-Württemberg, die Bayrische KI Agentur, #ai_Berlin und der Innovations Park Artifical Intelligence (IPAI) oder der KI Park e. V.
Zusammen mit meiner Ehefrau habe ich 2023 den Deutschen KI Monat mAI (www.ki-deutschland.de) ins Leben gerufen, den wir mit namhaften Partnern und Initiatoren des KI-Ökosystems deutschlandweit umsetzen. Die jährlich stattfindende KI-Kampagne hat in den ersten Jahren bereits mehr als 70 KI-Veranstaltungen zusammengebracht und fördert darüber den interdisziplinären Austausch zwischen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Forschung.
Außerdem habe ich 2023 mit fünf weiteren Partnern den AI Fund (ai-fund.vc) ins Leben gerufen, eine Venture-Capital-Firma, die dabei helfen wird, unser Geld und das weiterer Investor*innen zielgerichtet in die Zukunft europäischer KI-Firmen zu investieren.
Durch diese Tätigkeiten habe ich einen guten Überblick darüber, welche Unternehmen und Institute sich in Deutschland mit KI beschäftigen, wer sie nutzt und darüber aufklärt. Als Stadtstaat ist Berlin die klare Nummer eins, aber als Bundesland möchte ich den Süden der Bundesrepublik loben. Besonders Baden-Württemberg und Bayern geben sich viel Mühe, das Thema KI anzugehen.
In Bayern möchte ich in diesem Zusammenhang zwei Unternehmen erwähnen, die sehr viel Energie investieren, um über KI zu forschen und sie zu erklären. Die Applied AI Initiative GmbH und die Applied AI European Institut GmbH arbeiten eng mit der Technischen Universität München zusammen, bringen KI-Anwendungen hervor und treiben die Weiterbildung im Bereich KI bei Unternehmen und anderen Akteuren voran. Sie werden unter anderem von Susanne Klatten finanziert. Hier haben wir also ein Beispiel, bei dem der Kreislauf sehr gut funktioniert und „altes Geld“ (Frau Klatten) zurück in das Ökosystem fließt und Innovation und Aufbau fördert.
Auch die bayerische Landesregierung nimmt das Thema ernst. Das sehe ich unter anderem daran, dass bei KI-Veranstaltungen stets auch Staatssekretär*innen und Minister*innen präsent sind, es inzwischen einen Digitalminister gibt und das Land hohe Summen bereitstellt, den Austausch sucht und klar kommuniziert: „Wir wollen für Bayern eine KI-Industrie schaffen!“ Die zuständige Stelle, die Bayerische KI-Agentur, habe ich oben bereits erwähnt.
In Baden-Württemberg ist es ähnlich: Hier hat die Landesregierung 2021 einen Wettbewerb zur Realisierung eines KI-Innovationsparks in Höhe von 50 Millionen EUR ausgeschrieben. Heilbronn hat diesen Wettbewerb gewonnen und fand in der Schwarz-Gruppe einen privaten Investor, der nicht nur die 50 Millionen verdoppelte, sondern auch in Aussicht gestellt hat, bis zu 1 Milliarde EUR in das Innovationszentrum zu investieren. Auch hier steckt also „altes Geld“ drin, denn hinter der Schwarz-Gruppe stehen die Unternehmen Lidl und Kaufland. Die Dieter-Schwarz-Stiftung zeigt hierbei eine vorbildliche Präsenz in der Region. Aktuell investiert sie beispielsweise in das IPAI – ein großes lokales Ökosystem mit überregionaler Strahlkraft für KI in Europa, das derzeit in Heilbronn entsteht. Aber auch in das KI-Unternehmen Aleph Alpha hat sie investiert.
Gleichzeitig ist all das nicht ansatzweise mit den Größenordnungen der Innovationsparks in den USA und China vergleichbar. Damit du eine Vorstellung bekommst: Die Landesregierung Baden-Württemberg hat für das IPAI 50 Millionen EUR zur Verfügung gestellt und das Projekt wurde mit weiteren 50 Millionen von der Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt. Allein die chinesische Stadt Shanghai verfügt umgerechnet über ein KI-Budget von 10 Milliarden EUR. Das heißt, allein Shanghai investiert mehr in das Thema als Gesamtdeutschland in den letzten fünf Jahren.
Fast jedes Bundesland kann inzwischen eigene KI-Initiativen, -Hubs und -Ökosysteme vorweisen. Diese Metaebenen verteilen zwar meistens kein Geld, aber streben wenigstens Vernetzung an, indem sie Events organisieren, Gespräche anstoßen, Lobbyarbeit betreiben und über KI aufklären. In Hessen gibt es nicht nur die hessian.AI, sondern mit Prof. Dr. Kristina Sinemus aktuell sogar eine Digitalministerin, die sich wirklich politisch für das Thema stark macht.
Darüber hinaus gibt es in Deutschland auch jede Menge private Akteure, die KI vorantreiben. Natürlich möchte ich dich an dieser Stelle erneut auf die Rise of AI Conference aufmerksam machen, die meine Frau Veronika und ich seit 2016 jährlich veranstalten. Dazu laden wir jährlich die 200-300 wichtigsten Forscher*innen, Politiker*innen, Unternehmer*innen und Investor*innen ein und streamen die Veranstaltung parallel live und kostenfrei in die ganze Welt. Einmal im Jahr trifft sich das deutsche KI-Ökosystem live bei uns in Berlin und virtuell. Daraus entstehen jedes Mal fantastische Synergien und neue Projekte. Die Konferenz ist deshalb auch ein weiteres Beispiel dafür, dass Fortschritt und Innovation nur funktionieren können, wenn man die richtigen Menschen zur gleichen Zeit an ein und demselben Ort zusammenbringt.
Natürlich gibt es weitere Unternehmen und Netzwerke, die ebenfalls einiges leisten, um KI voranzutreiben.
Die Merantix AG vereint in Berlin unter ihrem Dach unter anderem das Venture Studio, einen eigenen Investitionsfond sowie Merantix Momentum und den AI Campus Berlin, eine Co-Working-Community für das KI-Ökosystem und eine Plattform für KI-Akteure. Das Team besteht aus mehr als 200 Mitgliedern aus über 30 Nationen. Alle paar Monate gelingt es in einem sehr guten Prozess, neue KI-Unternehmen zu gründen. Erfahrene Unternehmer*innen helfen Gründer*innen dabei, ihre Startups aufzuziehen und unterstützen sie mit Anschubfinanzierungen von 1-3 Millionen EUR. Dadurch können sich die Startups auf ihr Produkt konzentrieren und müssen sich weniger Sorgen um die Finanzierung machen. Denn in der Regel muss sich ein Startup-Team am Anfang zu 100 Prozent auf das Einsammeln von Kapital konzentrieren. Wenn aber schon früh im Prozess ausreichend Kapital zur Verfügung steht, kann sich das Team auf das eigentliche Produkt und die Entwicklung der Firma fokussieren. Merantix funktioniert also für Talente und Ideen wie ein Gewächshaus für neue Pflanzenarten. Das Unternehmen bietet zarten neuen Pflänzchen aber nicht nur Platz zum Gedeihen, sondern kümmert sich auch um sie. Hier wird nicht mit der Gießkanne wahllos Geld ausgeschüttet, sondern jede „Pflanze“ nach ihren individuellen Bedürfnissen gepflegt. Es gibt sogar einen hauseigenen Fonds (aktuelles Volumen: 35 Millionen EUR) und mit dem AI Campus ein sogenanntes „Office Space Konzept“: Hier sitzen auf 800 m² ungefähr 80 Unternehmen. Das heißt, wir haben eine Art Silicon Valley für KI im Kleinen. Denn hier begegnen sich täglich Kapitalgeber*innen, Forscher*innen, Unternehmer*innen und Kund*innen. Inzwischen gibt es auch Dependancen in anderen Städten und Ländern.
Fazit: insgesamt „ausbaufähig“
Ich fasse nochmal zusammen:
Wir haben großartige Forscher*innen, die sich teilweise schon seit 40 Jahren Künstlicher Intelligenz widmen und immer noch gründen. Wir sind in Deutschland eine KI-Familie, die miteinander kollaboriert. Das bedeutet aber auch, dass wir mit etwa 1.000 Akteuren, die sich wirklich jeden Tag mit KI beschäftigen, noch immer eine sehr kleine Industrie sind. Innerhalb dieses Ökosystems existiert eine fantastische Energie mit jeder Menge Innovationspotenzial. Die großartige Zusammenarbeit, der menschliche Austausch und die familiäre Atmosphäre haben mich persönlich auch durch die zermürbenden Corona-Jahre getragen. Alle arbeiten gemeinsam an dem Ziel, Deutschland nach vorne zu bringen und kämpfen jeden Tag dafür. Ich lade dich ein, einmal unsere Konferenz zu besuchen oder mir einfach mal eine E-Mail zu schreiben, denn ich helfe gerne jedem weiter, der sich intensiver mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen möchte.
Gleichzeitig fehlt es in Deutschland an allen Ecken und Enden, weil zu wenig leicht und schnell zugängliches Geld vom Staat und aus der etablierten Industrie in das Thema fließen. Es wird viel zu viel gefordert und zu wenig gefördert.
Seit 2023 sehe ich, dass auch die Bundesregierung das Thema endlich ernster nimmt und sich vermehrt dafür einsetzt, KI voranzutreiben. Wichtig ist, dass es weitergeht – denn das ist erst der Anfang. Bund und Länder müssen ihr Engagement nun weiter ausbauen und KI nachhaltig unterstützen und fördern. Ich bin zuversichtlich, dass das passieren wird.
Leider werden deutsche Startups noch zu selten von deutschen Unternehmen aufgekauft, sondern primär von amerikanischen oder israelischen Unternehmen. Das bedeutet wiederum, dass das Geld nicht im Kreislauf bleibt und wir Kapital verlieren, das in das deutsche Ökosystem zurückfließen sollte.
Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Doch obwohl wir bereits einiges tun und vieles angestoßen haben, sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene, ist es noch nicht genug. Ich bin der Meinung, dass Deutschland im Bereich KI noch viel mehr kann. Wir haben kluge Köpfe, starke Ideen und den Willen, Großes zu erschaffen, und ich finde, jetzt ist es an der Zeit, der Welt endlich zu zeigen, was wir auch im KI-Bereich können!
Doch um ein umfassenderes Bild davon zu bekommen, wie wir als deutsche KI-Nation nicht nur die deutsche Wirtschaft weiter antreiben, sondern auch Einfluss auf den Weltmarkt nehmen können, stellt sich zunächst die große Frage: Wie wird es mit Künstlicher Intelligenz weitergehen?
KI-Nation
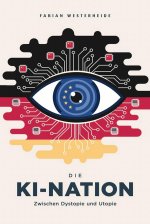
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus dem Buch “Die KI-Nation”. KI-Experte, Investor und Rise of AI-Macher Fabian Westerheide wirft mit “Die KI-Nation: Zwischen Dystopie und Utopie” ein Buch rund um das derzeitige Megathema Künstliche Intelligenz auf den Markt. Das Werk, das am 15. Mai erscheint, soll dabei ein “umfassender Leitfaden für alle, die die Zukunft mitgestalten wollen” sein. Westerheide sorgt sich dabei insbesondere um die Rolle Deutschland: “In diesem Wettlauf haben Länder wie die USA und China die Nase vorn, während Deutschland weiter zurückfällt. Das Land der Erfinder und Forscher muss jetzt handeln, um nicht den Anschluss zu verlieren.” Jetzt bei amazon bestellen
Startup-Jobs: Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? In der unserer Jobbörse findet Ihr Stellenanzeigen von Startups und Unternehmen.











