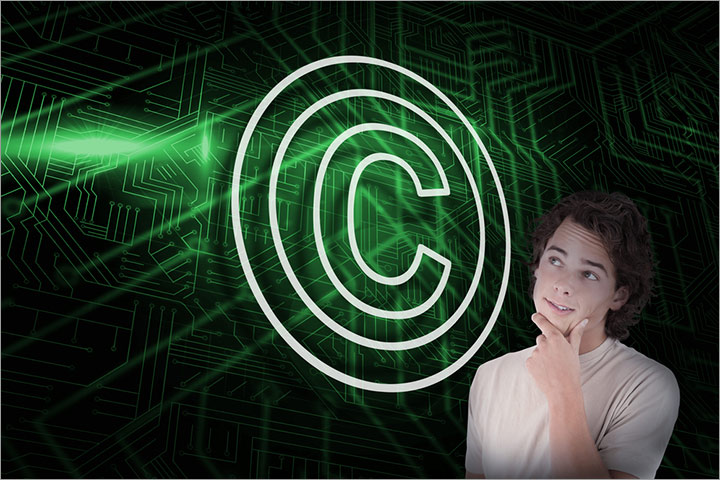
Start-ups und geistiges Eigentum
 |
Founder Associate (m/w/d) |
 |
Product Manager (m/w/d) |
 |
Influencer Marketing Manager/in (m/w/d) |
 |
Digital Marketing Spezialist (m/w/d) |
 |
Scrum Master (m/w/d) |
In der Startphase steht viel auf der To Do-Liste eines Gründers. Der Schutz des eigenen geistigen Eigentums (Intellectual Property, kurz: IP) wird daher gerne auf später verschoben. Dabei sollten wichtige Basics bei IP-Themen von Startups unbedingt von vornherein beachtet werden.
Dabei sind die wesentlichen Assets eines Start-Ups seine Idee, sein Team und das erworbene IP. Viele Fehler oder Nachlässigkeiten beim IP lassen sich nachträglich gar nicht oder nur unter hohem Aufwand und Kosten korrigieren. Von einem schlechten IP-Management ist ferner auch kein Investor begeistert.
Urheberrecht
Bei Start-Ups im Bereich Apps und Online spielt insbesondere das Urheberrechtsgesetz (kurz “UrhG”) eine wichtige Rolle. Daneben können aber auch z.B. das Designgesetz oder – bei technischen Erfindungen – das Patentgesetz dem Start-Up Schutz gewähren.
Das Urheberrechtsgesetz unterscheidet zwischen Urheberrechten und verwandten Schutzrechten. Urheberrechte entstehen an Werken, die das Resultat einer schöpferischen Leistung des Urhebers sind (§ 2 UrhG). Hierzu zählen z.B. Sprachwerke, wie etwa Computerprogramme, Lichtbildwerke, Musikwerke und auch Multimediawerke. Schutzvoraussetzung ist, dass die Werke persönliche geistige Schöpfungen sind.
Keinesfalls ist es hierzu aber erforderlich, dass es sich bei dem Werk um “große Kunst” handelt. Die Schwelle zur Schutzfähigkeit ist relativ niedrig. In der Regel sind daher z.B. Computerprogramme urheberrechtlich geschützt, sofern nicht lediglich das Werk eines anderen nachgeahmt wurde. Nicht schutzfähig ist lediglich Banales oder Routinemäßiges, was jeder andere ähnlich umsetzen würde. Wichtig ist jedoch, dass nicht bereits die abstrakte Idee schutzfähig ist, sondern erst ihre konkrete Ausdrucksform (z.B. der Quellcode, Objektcode, Assemblercode etc.).
Die verwandten Schutzrechte schützen hingegen keine schöpferische Leistung, sondern ähnliche Leistungen oder Leistungen, die in Zusammenhang mit den Werken der Urheber erbracht werden. Hierzu gehören z.B. das Recht des ausübenden Künstlers (§§ 73 ff. UrhG), des Tonträger- (§§ 85 f. UrhG), des Film- (§§ 94 f. UrhG) und des Datenbankherstellers (§§ 87a ff. UrhG).
Zu viele Köche verderben den Code?
Die wenigsten Produkte werden nun im stillen Kämmerlein von einer Person allein erschaffen. Der Regelfall ist vielmehr, dass ein Team, gerne auch in wechselnder Besetzung, aus einer Idee ein richtiges Produkt macht. Nachträgliche Streitigkeiten um die “wahre Urheberschaft” an einem Produkt gibt es in der Start-Up-Welt daher nicht erst seit der Auseinandersetzung zwischen den Winklevoss-Brüdern und Facebook.
Ein Urheberrecht an einem Werk entsteht in der Person, die das Werk erschaffen hat (‘Schöpferprinzip’ – § 7 UrhG). Die im US-amerikanischen Raum bestehende ‘Work for Hire’-Doctrine, d.h. der Auftraggeber wird automatisch der Urheber, existiert in dieser Gestalt in Deutschland nicht.
Bei Team-Arbeit werden in der Regel alle Team-Mitglieder Miturheber an dem Werk(§ 8 UrhG), sofern ihr jeweiliger Beitrag zum Werk für sich genommen schutzfähig ist. Ein Praktikant, der den Programmierern nur ‘Kaffee bringt’, wird daher nicht Miturheber.
Nutzungsrechteeinräumung und ‘Work for Hire’
Das Start-Up selbst, z.B. in Form einer GmbH, wird als juristische Person niemals Urheber und hat daher zunächst gar keine Rechte am Produkt. Diese muss es sich erst von den Urhebern einräumen lassen.
Ein Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden. Nur sofern und soweit das Start-Up über ein ausschließliches Nutzungsrecht verfügt, kann es gegen Drittnutzer vorgehen und z.B. Unterlassung fordern. Ist der Umfang der Nutzungsrechteeinräumung unklar, wird zugunsten des Urhebers unterstellt, dass Rechte nur soweit eingeräumt werden sollten, wie dies zur Erreichung des Vertragsziels erforderlich ist (“Zweckübertragungstheorie”).
Grundsätzlich empfiehlt es sich für ein Start-Up, bereits in den Arbeitsverträgen eine ausdrückliche Nutzungsrechteklausel vorzusehen. Fehlt es an einer solchen Klausel, so bietet § 43 UrhG dem Startup jedoch einen gewissen Schutz. Denn sofern ein Werk im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffen wurde, bleibt der Arbeitnehmer zwar Urheber, sein Arbeitgeber erhält jedoch die Nutzungsrechte am Werk, sofern nichts anders im Arbeitsvertrag vereinbart wurde.
Wie weit die Nutzungsrechte tatsächlich durch § 43 UrhG übertragen werden, ist jedoch jeweils im Einzelfall zu entscheiden, sodass hier gegenüber einer ausdrücklichen Nutzungsrechteklausel eine Rechtsunsicherheit verbleibt. Bei Computerprogrammen schützt das Start-up ferner der sogar etwas weiterreichende § 69b UrhG. In diesem Fall erhält der Arbeitgeber das alleinige Nutzungsrecht an dem Computerprogramm, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Freelancer gelten hingegen nicht als Arbeitnehmer, sodass die §§ 43, 69b UrhG auf diese keine Anwendung finden. Hier kommt es allein darauf an, was mit diesen vertraglich vereinbart wurde. Fehlt es an einer hinreichenden Vereinbarung kann ein nachträgliches “Nachverhandeln” schnell teuer werden, gerade wenn das Start-Up bereits an Fahrt aufgenommen hat und auf das Werk des Freelancers zwingend angewiesen ist.
Schließlich ist auch sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer oder Freelancer nicht (unbemerkt) Teile ins Produkt einbringt, an denen er bereits im Rahmen eines vorherigen Projekts/Jobs seinem damaligen Arbeit- bzw. Auftraggeber die ausschließlichen Nutzungsrechte eingeräumt hat. Ansonsten droht, dass dieser das Start-Up auf Unterlassung oder Schadensersatz in Anspruch nimmt. Da man sich dessen als Start-Up nie 100-prozentig sicher sein kann, sollte man sich zumindest eine entsprechende Garantie vom Arbeitnehmer/Freelancer geben und sich vom ihm ggf. auch von der Inanspruchnahme durch Dritte freistellen lassen.
Extra-Lohn für Nutzungsrechteeinräumung?
Die Nutzungsrechteeinräumung ist im Normalfall bereits durch das Arbeitsentgelt mit abgegolten. Jedoch hat auch der angestellte Urheber grundsätzlich Anspruch auf eine angemessene Vergütung (§ 32 UrhG), was in Einzelfällen, z.B. bei einer deutlich unter dem Marktüblichen liegenden Arbeitslohn, auch zu Nachforderungen führen kann.
Ferner hat der Urheber nach dem sog. Bestsellerparagraphen (§ 32a UrhG) einen Anspruch auf eine angemessene Beteiligung, wenn seine Vergütung in einem auffälligen Missverhältnis zu dem steht, was der andere (später) an Erträgen und Vorteilen aus der Werknutzung erhält. Wenn zum Beispiel der Urheber einem jungen – chronisch unterfinanziertem – Startup die Nutzungsrechte günstig einräumt und dieses dann “durch die Decke geht” und ein millionenschwerer Erfolg wird, kann der Bestsellerparagraph unter Umständen zur Anwendung kommen.
Einmal Open Source, immer Open Source?
Bei der Verwendung von Open Source Content ist Vorsicht geboten. Denn die Open-Source-Nutzungsbedingungen können gerade die kommerzielle Verwendung des Endprodukts erheblich einschränken. Auch Open Source Content unterliegt nämlich dem Urheberrechtsschutz und ist keinesfalls per se gemeinfrei.
Der Rechteinhaber ‘verzichtet’ vielmehr auf die Geltendmachung seiner Rechte im Wege einer standardisierten Lizenz, wie z.B. der GNU General Public License (GPL). Diese enthält teilweise erhebliche Beschränkungen, was die Verwendung von Open Source Software in kommerzieller Software angeht.
So müssen z.B. Modifikationen an einer der GPL unterliegenden Open Source Software im Falle der Weiterverbreitung wiederum der GPL unterliegen. Eine Nutzung von Teilen in kommerzieller Software ist in diesem Fall nicht möglich. Dies ist sehr ärgerlich, wenn man als Start-Up tatsächlich aber sein Produkt verkaufen möchte.
Namensgebung und Markenrecht
Von erheblicher Bedeutung ist auch die Namensgebung des Produkts. Aus markenrechtlicher Sicht ist hier zum einen zu beachten, ob der gewünschte Name überhaupt noch frei verfügbar ist, und zum anderen, ob und wie gut man diesen Namen markenrechtlich schützen lassen kann.
Allein das Sichern von Domains und Social Media-Accounts mit dem entsprechenden Namen reicht dabei nicht, um seinen Namen wirksam zu schützen. Vielmehr sollte man bereits bei der Namensfindung prüfen, ob der Name überhaupt noch frei verfügbar ist oder nicht andere ihn schon als Marke oder sonstiges Kennzeichen haben schützen lassen. Denn ist der Name bereits von jemand anderes als Marke eingetragen, kann die Benutzung dieses Namens untersagt werden.
Die öffentlich zugänglichen Online-Markenregister sind insoweit eine gute erste Recherchemöglichkeit, z.B. das DPMA-Register.
Jedoch kann man hier nur nach konkreten Namen und Schreibweisen suchen. Ähnliche Marken, die einer eigenen Nutzung ebenfalls entgegenstehen, werden dabei nicht angezeigt. Ferner können einer Namensnutzung auch andere Rechte entgegenstehen, die nicht aus dem Markenregister ersichtlich sind, z.B. Namensrechte, Unternehmenskennzeichen etc. In der Regel wird man daher – gerade bei größeren internationalen Projekten – einen externen Dienstleister mit einer Recherche beauftragen.
Sobald man sich für einen Namen entschieden hat, sollte man diesen möglichst schnell rechtlich schützen lassen, indem man ihn als Marke anmeldet. Im Markenrecht gilt grundsätzlich “first come, first served”, d.h. es gewinnt derjenige, der die Marke zuerst angemeldet hat.
Als Marken können Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 3 Markengesetz). Neben Wörtern können z.B. auch graphische Abbildungen (z.B. ein Logo), 3-D-Gestaltungen oder selbst akustische Erkennungsmittel als Zeichen schutzfähig sein.
Eine eingetragene Marke schützt den Inhaber davor, dass andere sein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzen. Schutz besteht dabei nicht nur gegen die identische Übernahme, wie z.B. bei Plagiate, sondern auch gegen die Verwendung von verwechslungsfähigen Zeichen.
Der Markenschutz gilt nur für das Land, in dem die Marke eingetragen wurde. Will man als Start-Up seinen Namen in mehreren Ländern schützen, so muss man grundsätzlich in jedem Land eine gesonderte nationale Marke registrieren. Eine Ausnahme hiervon bietet die Gemeinschaftsmarke, die Schutz in allen EU-Mitgliedstaaten bietet. Eine Gemeinschaftsmarke ist beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) anzumelden.
Bei der Anmeldung einer Marke muss ein Waren- und Dienstleistungsverzeichnis beigefügt werden, mit welchem der Anmelder festlegt, für welche Waren und Dienstleistungen seine Marke eingetragen und somit auch geschützt werden soll.
Für die Eintragung einer nationalen Marke erhebt das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) eine Anmeldegebühr von 300 Euro bzw. 290 Euro bei einer Online-Anmeldung. Will man die Marke für mehr als drei Waren und Dienstleistungsklassen anmelden wird für jede weitere Klasse eine Gebühr von 100 Euro fällig. Gegen eine gesonderte Gebühr von 100 Euro wird eine beschleunigte Prüfung der Anmeldung vorgenommen. Für eine Online-Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke mit bis zu drei Klassen werden 900 Euro fällig. Jede weitere Klasse kostet 150 Euro.
Nach der Anmeldung erfolgt zunächst eine Prüfung durch das jeweilige Amt auf formelle Fehler und Eintragungshindernisse. Kommt es hier nicht zu Beanstandungen durch das Amt, wird die Anmeldung veröffentlicht und Dritte können binnen einer Widerspruchsfrist Widerspruch gegen die Eintragung erheben (z.B. weil sie ein älteres Recht an dem Zeichen haben). Endet die Widerspruchsfrist ohne einen berechtigten Widerspruch wird die Marke schließlich ins Markenregister eingetragen.
Bei einer Markenanmeldung empfiehlt sich regelmäßig die rechtzeitige Beratung durch einen mit der Materie vertrauten Rechtsanwalt, damit potentielle Beanstandungen und Widersprüche rechtzeitig erkannt und daraus resultierende Kosten möglichst vermieden werden können.
Fazit
Natürlich hängt der Erfolg eines Start-Ups zunächst einmal von der Überzeugungskraft seines Produkts ab. Ein schlechtes Produkt wird auch durch optimalen IP-Schutz nicht besser. Aber ein gutes Produkt wird ohne IP-Schutz schnell kopiert. Daher sollte ein Start-Up frühzeitig das Thema IP in Angriff nehmen.
Dazu gehört vor allem, dass sich das Start-Up die entsprechenden Nutzungsrechte am Produkt und seinen Bestandteilen möglichst umfangreich einräumen lässt und dies auch beweiskräftig dokumentiert (d.h. schriftliche Verträge, keine mündlichen Zusagen o.ä.). Denn im Streitfall muss das Start-Up seine Rechteinhaberschaft vor Gericht darlegen und beweisen können.
Bei der Namensfindung sollten von Beginn an markenrechtliche Erwägungen berücksichtigt und möglichst schnell ein Markenschutz durch entsprechende Anmeldung begründet werden.
Zur Person
Dr. Bahne Sievers berät als Rechtsanwalt bei Bird & Bird LLP, Hamburg seit Jahren vor allem nationale und internationale Medienunternehmen sowie Startups im Bereich IP und Commercial. Einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet insbesondere die Beratung von digitalem Content-Vertrieb, Apps, Online-Auftritten und Social Media.
Bird & Bird ist eine internationale Anwaltssozietät mit einem außergewöhnlichen Verständnis für strategische und unternehmerische Zusammenhänge. “Wir verbinden erstklassige rechtliche Expertise mit tiefgehender Branchenkenntnis und einer erfrischend kreativen Denkweise.
Mit 1.100 Anwälten sind wir in 27 Büros in 18 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und im Asien-Pazifik-Raum vertreten, davon mit über 200 Anwälten in den Wirtschaftszentren Düsseldorf, Frankfurt, München und Hamburg.
Darunter befinden sich Experten aus verschiedenen Industriesektoren, die die gesamte Bandbreite des Wirtschafts- und Unternehmensrechts abdecken – insbesondere in Bereichen, in denen Technologie, Regulierung und gewerblicher Rechtsschutz eine besondere Rolle spielen. Wir teilen die Leidenschaft unserer Mandanten für ihre Arbeit und sind damit so vertraut, wie es sonst nur Insider sind.”
